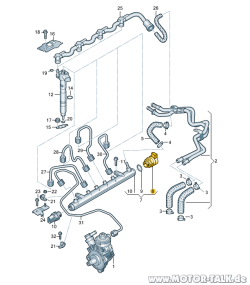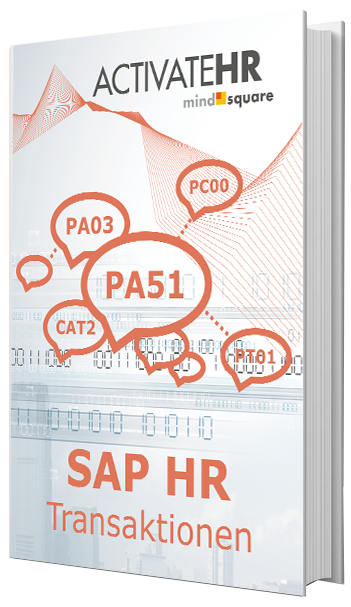Ständig geschieht das, ob wir es im Vorhinein wissen oder nicht: Irgendwann kommt der letzte Tag. Heute heißt es für mich also aufstehen, meine Sachen packen – nicht bloß den kleinen Handkoffer, der mir in meinem provisorischen Alltag unersetzliche Dienste geleistet hat – und mehrere Züge nehmen, die mich, voraussichtlich um vier Uhr nachmittags, in Köln absetzen werden. Zum ersten Mal seit ich in diesem Hotel eine vorläufige Heimat gefunden habe, unterläuft den Leuten von der Rezeption ein Irrtum und sie wecken mich eine Stunde früher als vereinbart. Ich nehme es als eines der vielen guten Vorzeichen, die mir in dieser Stadt schon zugekommen sind, was sich später auch bestätigt: Obwohl ich eine Stunde mehr Zeit gehabt habe, komme ich gerade noch rechtzeitig beim Bahnhof an. Außerdem mit zweiundfünfzig Kilo Gewicht im Schlepptau.
Ich atme auf: Der Anzeigetafel nach hat mein Zug Verspätung, wieviel Verspätung genau wird allerdings nicht verraten. Ich schleppe mich mit meinem Gepäck zum Informationsschalter, um diesbezüglich Erkundigungen einzuziehen, in Frankfurt habe ich nämlich bloß zwölf Minuten Zeit zum Umsteigen. Als ich endlich an die Reihe komme (an den Schaltern sämtlicher Bahnhöfe in Deutschland musste ich mich anstellen, was mir unangenehm bekannt vorkam), stelle ich fest, dass auch die Frau auf der anderen Seite des Schalters zu den Leuten gehört, die a little bit Englisch sprechen. Ihre zwei mit blauen Anzügen bekleideten Kolleginnen ebenfalls. Trotzdem versuche ich herauszufinden, was ich wissen möchte. Hartnäckig. Bis ich es mit Tränen in den Augen irgendwann aufgebe. Ich schultere erneut meine zweiundfünfzig Kilo und kehre zum Bahnsteig zurück, entschlossen, den nächsten halbwegs passenden Zug zu besteigen. Dass der, den ich eigentlich hätte nehmen sollen, inzwischen, wenn auch verspätet, nicht nur längst eingetroffen, sondern auch schon wieder weitergefahren ist, scheint mir klar.
![© María Sonia Cristoff © María Sonia Cristoff]()
Und so ist es auch: Der Zug ist weg, und damit auch mein Anschlusszug, beziehungsweise meine Anschlusszüge. Auch wenn mich das ärgert, wundert es mich nicht: Jedes Mal wenn ich von Leipzig aus für einen oder zwei Tage in eine andere Stadt fahren wollte, hatte ich Schwierigkeiten mit den Zügen. Wie aus heiterem Himmel, als hätte eine außer Kontrolle geratene Maschinerie es so verfügt, fuhren sie von einem anderen Bahnsteig ab, oder kamen zu spät, oder es hieß – kaum hatte man sich, mal mehr, mal weniger zufrieden mit der Nische, die man hatte aufstöbern können, um das Gepäck abzustellen, auf seinem reservierten Sitzplatz niedergelassen –, die Passagiere müssten sich in einen anderen Wagon begeben, mit der Folge, dass die betroffenen Passagiere sich wütend beschwerten. Wenn etwas dafür gesorgt hat, den Mythos von der deutschen Pünktlichkeit und Ordnungsliebe in meinen Augen zu zerstören, dann meine Zugreisen. Worüber ich andererseits sehr erleichtert bin, auch wenn es in diesem Fall zur Folge hatte, dass ich auf meiner Abschiedsreise von Leipzig aus immer wieder unter Aufbietung meiner letzten Kräfte zweiundfünfzig Kilo Gewicht eine Rolltreppe hinauf- und hinunterbefördern musste, bis ich schließlich in bedauernswertem Zustand und ohne auch nur eine Minute Zeit zu haben, um mich einzustimmen, an dem Ort eintraf, wo ich zusammen mit mehreren anderen Schriftstellern auf einem Podium Platz nehmen sollte.
![© María Sonia Cristoff © María Sonia Cristoff]()
Als wir Schriftsteller nach der Veranstaltung von unseren Gastgebern mit einer selten köstlichen Suppe bewirtet werden, erzähle ich einem deutschen Journalisten, der neben mir am Tisch sitzt, dass mein erster Zug Verspätung hatte, weil sich jemand davor warf. Ausgerechnet heute musste der sich zum Selbstmord entschließen, füge ich hinzu. Von wegen, das hätte genauso gut gestern passieren können, oder auch morgen, sagt der Journalist. Und erzählt mir von Robert Enke, dem Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft, der bereits für mehrere große Vereine Europas gespielt hatte, aber vor nicht einmal einem Jahr in der Nähe von Hannover sein Auto an einer Bahnstrecke abstellte, seine Brieftasche auf den Beifahrersitz legte, ausstieg und sich vor einen Zug warf. Aus naheliegenden Gründen berichteten alle Zeitungen darüber, anders als in den vielen tausenden ähnlichen Fällen. Angeblich würde eine vergleichbar ausführliche Berichterstattung so manchen zur Nachahmung verleiten, ja schlimmstenfalls eine ganze Selbstmordserie auslösen. Genau dieselbe Theorie hatte ich schon einmal in Las Heras zu hören bekommen, einem Ort in Patagonien, wo sich in den Jahren um den Jahrtausendbeginn sechsundzwanzig Jugendliche in erschreckend gleichmäßigen zeitlichen Abständen das Leben nahmen, im Schnitt etwa alle zwei Monate einer, und fast alle erhängten sich. Überrascht bin ich dennoch. Als ich der Sache damals in dem geisterhaften Ort nachging, um anschließend etwas darüber zu schreiben, hielt ich die Idee für ziemlich abwegig, so als könnte man bloß an einem so weit von allen Diskussionen über Kultur und Gesellschaft entfernten Ort auf derlei Vorstellungen verfallen, die typische Vogel-Strauß-Reaktion eines Dorfes eben, das, bevor es seinen gegenwärtigen Namen erhielt, tatsächlich „Straußenspur“ hieß. Trotz aller der Kultur geschuldeten Unterschiede verbindet uns jedoch offensichtlich die Neigung, Selbstmorde, wenn sie reihenweise auftreten, nicht als Vielzahl von Einzelschicksalen, sondern als Ausdruck einer gesellschaftlichen Erkrankung zu betrachten, der man etwas entgegenhalten muss. Mir läuft ein Schauer über den Rücken. Während meine Schriftstellerkollegen sich gleichzeitig über lauter verschiedene Dinge unterhalten, sage ich mir, dass ich etwas dafür gäbe, nicht in diesem Zug gesessen zu haben. Oder gar nicht aus Leipzig abgereist zu sein. Trost finde ich erst, als ich mich wieder der köstlichen Suppe zuwende und mir „Chili“ in Erinnerung rufe, einen Parson Jack Russell Terrier, der mir im Zug gegenüber saß. Nicht zum ersten Mal verlasse ich bedrückter Stimmung einen Ort, um mich unversehens in Gesellschaft eines Hundes wiederzufinden, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, mich zu beschützen.
![© María Sonia Cristoff © María Sonia Cristoff]()
Übersetzung: Peter Kultzen
Ich atme auf: Der Anzeigetafel nach hat mein Zug Verspätung, wieviel Verspätung genau wird allerdings nicht verraten. Ich schleppe mich mit meinem Gepäck zum Informationsschalter, um diesbezüglich Erkundigungen einzuziehen, in Frankfurt habe ich nämlich bloß zwölf Minuten Zeit zum Umsteigen. Als ich endlich an die Reihe komme (an den Schaltern sämtlicher Bahnhöfe in Deutschland musste ich mich anstellen, was mir unangenehm bekannt vorkam), stelle ich fest, dass auch die Frau auf der anderen Seite des Schalters zu den Leuten gehört, die a little bit Englisch sprechen. Ihre zwei mit blauen Anzügen bekleideten Kolleginnen ebenfalls. Trotzdem versuche ich herauszufinden, was ich wissen möchte. Hartnäckig. Bis ich es mit Tränen in den Augen irgendwann aufgebe. Ich schultere erneut meine zweiundfünfzig Kilo und kehre zum Bahnsteig zurück, entschlossen, den nächsten halbwegs passenden Zug zu besteigen. Dass der, den ich eigentlich hätte nehmen sollen, inzwischen, wenn auch verspätet, nicht nur längst eingetroffen, sondern auch schon wieder weitergefahren ist, scheint mir klar.

Und so ist es auch: Der Zug ist weg, und damit auch mein Anschlusszug, beziehungsweise meine Anschlusszüge. Auch wenn mich das ärgert, wundert es mich nicht: Jedes Mal wenn ich von Leipzig aus für einen oder zwei Tage in eine andere Stadt fahren wollte, hatte ich Schwierigkeiten mit den Zügen. Wie aus heiterem Himmel, als hätte eine außer Kontrolle geratene Maschinerie es so verfügt, fuhren sie von einem anderen Bahnsteig ab, oder kamen zu spät, oder es hieß – kaum hatte man sich, mal mehr, mal weniger zufrieden mit der Nische, die man hatte aufstöbern können, um das Gepäck abzustellen, auf seinem reservierten Sitzplatz niedergelassen –, die Passagiere müssten sich in einen anderen Wagon begeben, mit der Folge, dass die betroffenen Passagiere sich wütend beschwerten. Wenn etwas dafür gesorgt hat, den Mythos von der deutschen Pünktlichkeit und Ordnungsliebe in meinen Augen zu zerstören, dann meine Zugreisen. Worüber ich andererseits sehr erleichtert bin, auch wenn es in diesem Fall zur Folge hatte, dass ich auf meiner Abschiedsreise von Leipzig aus immer wieder unter Aufbietung meiner letzten Kräfte zweiundfünfzig Kilo Gewicht eine Rolltreppe hinauf- und hinunterbefördern musste, bis ich schließlich in bedauernswertem Zustand und ohne auch nur eine Minute Zeit zu haben, um mich einzustimmen, an dem Ort eintraf, wo ich zusammen mit mehreren anderen Schriftstellern auf einem Podium Platz nehmen sollte.

Als wir Schriftsteller nach der Veranstaltung von unseren Gastgebern mit einer selten köstlichen Suppe bewirtet werden, erzähle ich einem deutschen Journalisten, der neben mir am Tisch sitzt, dass mein erster Zug Verspätung hatte, weil sich jemand davor warf. Ausgerechnet heute musste der sich zum Selbstmord entschließen, füge ich hinzu. Von wegen, das hätte genauso gut gestern passieren können, oder auch morgen, sagt der Journalist. Und erzählt mir von Robert Enke, dem Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft, der bereits für mehrere große Vereine Europas gespielt hatte, aber vor nicht einmal einem Jahr in der Nähe von Hannover sein Auto an einer Bahnstrecke abstellte, seine Brieftasche auf den Beifahrersitz legte, ausstieg und sich vor einen Zug warf. Aus naheliegenden Gründen berichteten alle Zeitungen darüber, anders als in den vielen tausenden ähnlichen Fällen. Angeblich würde eine vergleichbar ausführliche Berichterstattung so manchen zur Nachahmung verleiten, ja schlimmstenfalls eine ganze Selbstmordserie auslösen. Genau dieselbe Theorie hatte ich schon einmal in Las Heras zu hören bekommen, einem Ort in Patagonien, wo sich in den Jahren um den Jahrtausendbeginn sechsundzwanzig Jugendliche in erschreckend gleichmäßigen zeitlichen Abständen das Leben nahmen, im Schnitt etwa alle zwei Monate einer, und fast alle erhängten sich. Überrascht bin ich dennoch. Als ich der Sache damals in dem geisterhaften Ort nachging, um anschließend etwas darüber zu schreiben, hielt ich die Idee für ziemlich abwegig, so als könnte man bloß an einem so weit von allen Diskussionen über Kultur und Gesellschaft entfernten Ort auf derlei Vorstellungen verfallen, die typische Vogel-Strauß-Reaktion eines Dorfes eben, das, bevor es seinen gegenwärtigen Namen erhielt, tatsächlich „Straußenspur“ hieß. Trotz aller der Kultur geschuldeten Unterschiede verbindet uns jedoch offensichtlich die Neigung, Selbstmorde, wenn sie reihenweise auftreten, nicht als Vielzahl von Einzelschicksalen, sondern als Ausdruck einer gesellschaftlichen Erkrankung zu betrachten, der man etwas entgegenhalten muss. Mir läuft ein Schauer über den Rücken. Während meine Schriftstellerkollegen sich gleichzeitig über lauter verschiedene Dinge unterhalten, sage ich mir, dass ich etwas dafür gäbe, nicht in diesem Zug gesessen zu haben. Oder gar nicht aus Leipzig abgereist zu sein. Trost finde ich erst, als ich mich wieder der köstlichen Suppe zuwende und mir „Chili“ in Erinnerung rufe, einen Parson Jack Russell Terrier, der mir im Zug gegenüber saß. Nicht zum ersten Mal verlasse ich bedrückter Stimmung einen Ort, um mich unversehens in Gesellschaft eines Hundes wiederzufinden, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, mich zu beschützen.

Übersetzung: Peter Kultzen